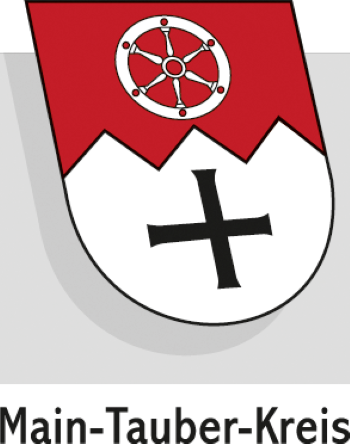300. Todestag von Joseph Hartmann: Einer der großen neuzeitlichen Äbte in Bronnbach (Teil 1 von 3)
Im Kloster Bronnbach verstarb am 19. Dezember 1724, vor genau 300 Jahren, Abt Joseph Hartmann. Er war einer der großen neuzeitlichen Äbte der Zisterzienserabtei im Taubertal. Er hat mit seinen Baumaßnahmen das Bild von Kloster Bronnbach bis auf den heutigen Tag nachhaltig geprägt, unter anderem mit dem Bau des nach ihm benannten Josephsaales. Dies ist Anlass, seinem Leben in einer dreiteiligen Serie nachzugehen. Die drei Teile handeln vom Beginn und Ende seiner Amtszeit, von seinem Werk als Bauherr sowie von seinem Wirken als Landesherr und Ordensmann.
Teil 1: Beginn und Ende der Amtszeit
Möglich war Abt Joseph Hartmanns enormes Wirken als Bauherr, weil bereits sein Amtsvorgänger Abt Wundert, wie Hartmann aus Grünsfeld stammend, die Abtei nicht zuletzt mit seinem familiären Vermögen stabilisiert und in jeder Hinsicht neu aufgestellt hatte. Beiden Äbten waren zudem lange Regierungszeiten gegönnt. Abt Franziskus war seit 1670 im Amt und verstarb am 10. September 1699. Abt Joseph lenkte ein Vierteljahrhundert, von 1699 bis 1724, die Klostergeschicke.
Geboren war er am 20. November 1660 in Grünsfeld als Sohn von Johannes Hartmann und seiner Ehefrau Anna. Über seine Kindheit und Jugend in Grünsfeld sowie seine dort erfolgte Schulbildung ist nichts bekannt. Im Alter von 19 Jahren hatte er sich 1679 für den Eintritt in das Kloster Bronnbach entschieden. Seinen Taufnamen Johannes Albert vertauschte der neue Ordensangehörige bei seiner Profess mit dem Mönchsnamen Josephus.
Nach ersten Unterrichtungen durch den Novizenmeister des Klosters dürfte er die nahegelegene Universität Würzburg besucht haben. Dort erhielt er auch die Weihen zum Subdiakon, Diakon und Priester. Von 1686 bis 1691 bekleidete er im Kloster das Amt des Priors, anschließend war er bis 1696 Pfarrer in Uissigheim. 1696/97 wurde er erneut zum Prior bestimmt. Dieses Amt war eine ideale Ausgangsposition für das höchste Klosteramt. Denn bei Abwesenheit und besonders nach dem Tod eines Abtes fiel dem Prior als Vertreter des Klosters schließlich eine besondere Rolle zu.
Über die Vorbereitung und die Abhaltung seiner Wahl informiert ein Eintrag im Kanzlei- und wöchentlichen Klagprotokoll über Reicholzheim und Dörlesberg bis in alle Einzelheiten. Nach dem Tod von Abt Wundert am 10. September 1699 waren der Ebracher Abt Candidus Pfister sowie der Würzburger Fürstbischof Johann Philipp von Greiffenclau zu Vollraths benachrichtigt worden. Würzburg entsandte daraufhin eine vierköpfige Kommission nach Bronnbach. Am 12. September erfolgte eine erste Beratung der Kommission mit dem Prior und den älteren Mönchen. Dieser schloss sich eine Inventur der Kloster- und Abtsräume an, die wie die vorherige Schlüsselübergabe unter Protest der Bronnbacher erfolgte.
Am 13. September traf Abt Pfister von Ebrach im Kloster ein, tags darauf fand die feierliche Beisetzung von Abt Wundert statt. Im Anschluss besprachen die bischöflichen und zisterziensischen Vertreter den weiteren Ablauf der Wahl, konnten sich aber nicht einigen. Im Wesentlichen ging es um den Vorsitz bei der anstehenden Wahl. Nach zähen Verhandlungen und geschicktem Agieren der Ordensvertreter konnte die Wahl am 19. September endlich stattfinden.
21 anwesende Wähler erkoren ihren bisherigen Prior, der mit knapp 39 Jahren zu den jüngeren Mitgliedern der Gemeinschaft zählte, zu ihrem neuen Abt. Damit waren die offiziellen Schritte zu dessen Dienstantritt längst nicht abgeschlossen. Am 23. September fuhr Abt Joseph nach Würzburg, um sich beim Fürstbischof als zuständigem Diözesanbischof und Schutzherrn des Klosters vorzustellen.
An der Türe der Domkirche, dem „Infokanal“ der damaligen Zeit, wurde die Proklamation des Bronnbacher Abtes angeschlagen. Wer Einwände dagegen hätte, sollte diese vorbringen. Am 12. November erfolgte dann endlich die bischöfliche Bestätigung in den Räumen der Residenz.
Auch der Generalabt des Zisterzienserordens bestätigte am 7. Januar 1700 die Wahl. Damit konnte die Weihe des Abts geplant werden, die erstmals im Kloster selbst stattfinden sollte. Sie erfolgte am 23. Mai 1700 mit großem Gepränge, „welche niehmahlen in dem gantzen Hochstifft Würtzburg in solchem pomp und ansehnlichen comitat geschehen ist“.
Neben vielen geistlichen und weltlichen Personen waren auch zahlreiche nichtkatholische Wertheimer bei der Weihe anwesend, ebenso die Eltern des neu geweihten Abts. Vom Konvent wurde dem Abt eine Huldigungsschrift gewidmet.
Die Abtsweihe war eine teure Angelegenheit für das Kloster. Nicht nur die Bewirtung der zahlreichen Gäste, sondern auch kostspielige Ehrengeschenke belasteten die Klosterkasse. Der Fürstbischof ließ dem Kloster an dem ausstehenden subsidium charitativum, einer Steuerzahlung an das Bistum, deswegen 2000 fränkische Gulden nach.
Diesem glanzvollen Anfang stand nach 25 erfolgreichen Jahren des Wirkens für sein Kloster ein recht abruptes Ende gegenüber. Abt Joseph war seit seinem Amtsantritt bemüht, sein Kloster baulich zu erneuern. Ab 1722 stand das Refektorium, der Speisesaal, zum Umbau an. Der Abt wollte sich immer wieder vom Fortgang der Bauarbeiten überzeugen, die Ende 1724 schon weit fortgeschritten waren.
Auf dem Weg zum neuen bau stürzte er am 30. November oder 1. Dezember 1724, ganz genau weiß man es nicht. Dabei zog er sich vor allem am Kopf schwere Verletzungen zu. Allem Anschein nach war er nach dem Sturz halbseitig gelähmt, vielleicht hatte auch ein Schlaganfall erst zum Sturz geführt. Trotz ärztlicher Bemühungen verstarb Abt Joseph nach 19-tägigem Leiden an den Folgen der von Sturz und Schlaganfall herrührenden leibs schwachheit am 19. Dezember 1724 morgens gegen 5 Uhr. Er wurde 64 Jahre alt.
Es folgten die üblichen Vorkehrungen beim Todesfall eines Abts. Sowohl der Fürstbischof als auch der Ebracher Abt wurden verständigt. Wegen des bevorstehenden Weihnachtsfestes war vor allem für die Beerdigung höchste Eile geboten, sie wurde für den 23. Dezember 1724 vormittags angesetzt.
Nach den im Orden üblichen Zeremonien wurde der Sarg in die Kirche getragen und vor dem Chor abgestellt. Es folgte ein feierliches Requiem und schließlich die Beisetzung im nördlichen Querhaus der Kirche. Der Ort seines Grabes wurde mit einer kunstvoll gestalteten Grabplatte bedeckt. Diese hatte Joseph Hartmann ganz nach den Gepflogenheiten der Zeit bereits 1712 von Balthasar Esterbauer anfertigen lassen. Fraglich ist, ob es sich bei der dargestellten Person um das realistische Abbild von Abt Joseph handelt oder ob es nicht eher einen idealtypischen, an den älteren Gedächtnismalen orientierten Bronnbacher Klostervorsteher zeigt.
Im Josephsaal, der unter seinem Nachfolger 1725 vollendet wurde, erinnert ein Medaillon an der Decke an den plötzlichen Tod des Abtes. Der Sensenmann schneidet eine Lilie, Teil des persönlichen Abtswappens, ab und symbolisiert damit das Ende von Abt Joseph. Vermutlich hat sich aus dieser Darstellung die Überlieferung entwickelt, der Abt wäre durch einen Sturz vom Baugerüst zu Tode gekommen. Die Inschrift über dem Medaillon nennt sein Todesjahr: 1724.