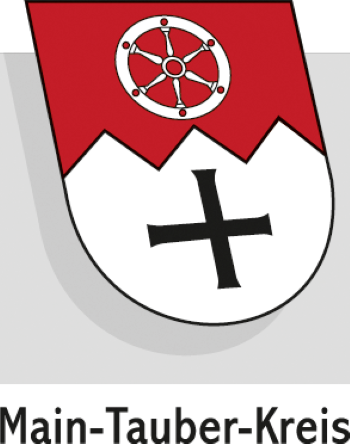300. Todestag von Abt Joseph Hartmann - Als Bauherr das Kloster Bronnbach bis heute geprägt (Teil 2 von 3)
Im Kloster Bronnbach verstarb am 19. Dezember 1724, vor 300 Jahren, Abt Joseph Hartmann. Er war einer der großen neuzeitlichen Äbte der Zisterzienserabtei im Taubertal und hat mit seinen Baumaßnahmen das Bild Bronnbachs bis auf den heutigen Tag nachhaltig geprägt. Dies ist Anlass, seinem Leben in einer dreiteiligen Serie nachzugehen. Teil zwei handelt von seinem Werk als Bauherr.
Teil zwei: Abt Joseph Hartmann als Bauherr
Mit zahlreichen Baumaßnahmen zwischen 1700 und 1730 wurde Kloster Bronnbach unter Abt Joseph und seinem Nachfolger Engelbert Schäffner barock umgestaltet. Die größeren Maßnahmen lassen sich vor Ort leicht entdecken, weil sie Abt Joseph mit seinem Wappen schmücken ließ. Dieses dreigeteilte Wappen zeigt links den schräg verlaufenden geschachten Zisterzienserbalken über einem Abtsstab (Ordenswappen) und rechts einen dreischaligen Springbrunnen (Klosterwappen). In der Mitte befindet sich das persönliche Wappen der Familie Hartmann, ein Krieger, ein „Hartmann“, der in seiner rechten Hand vermutlich eine Lilie hält.
Als erstes wandte Abt Joseph seine Aufmerksamkeit der Bronnbacher Klosterkirche zu, die er vor allem im Inneren wesentlich umgestaltete. Die liturgisch nicht mehr benötigte steinerne Chorschranke wurde durch ein schmiedeeisernes filigranes Gitter ersetzt. Der nun optisch einheitliche Kirchenraum wurde entsprechend einheitlich ausgestattet und inszeniert.
Bei Würzburger Künstlern wie Balthasar Esterbauer und Oswald Onghers gab er Neuanfertigungen mehrerer Altäre in Auftrag, die zwischen 1704 und 1707 geschaffen wurden. Die alten Altäre erhielten teils neue Standorte. Ein neuer Hochaltar kam 1712 bis 1714 dazu, inklusive einer Ausschmückung des Chorraums mit Sesseln für Abt und Prior sowie einer Holzvertäfelung mit Intarsienarbeiten. Die gesamte Raumausstattung bis hin zur Kanzel weist dieselben Schmuckelemente auf, so dass die Innenausstattung wie aus einem Guss wirkt.
1704/05 wurde östlich der Klausur die auch als neuer Konventbau bezeichnete Infirmerie, das Klosterspital, errichtet. Auch hier dokumentierte Abt Joseph mit Wappen und der Figur des Heiligen Joseph über dem Eingangsportal seine Bauherrschaft.
1722 bis 1725 wurde der Refektoriumsbau verlängert. Auf den als Sommerrefektorium genutzten alten Speisesaal wurde ein repräsentativer Festsaal aufgesetzt. In diesem künstlerisch reich ausgestatteten Saal verweisen gemalte Szenen aus der Geschichte des ägyptischen Joseph auf den Bauherrn, weswegen der Saal heute nach Abt Joseph benannt und als Josephsaal bekannt ist. In den Feldern der Wandvertäfelung unterhalb der Fenster finden sich Abbildungen des Klosters und seiner wichtigsten Besitzungen, so unter anderem der Klosterdörfer Reicholzheim und Dörlesberg.
Die Verlängerung des Ostflügels der Klausur auf die Höhe von Abteibau (Westflügel) und Refektorium und deren einheitliche Gestaltung mit Volutengiebeln schuf eine neue, eindrucksvolle Südansicht der Klosteranlage. Diese Ansicht lässt sich besonders gut vom neu geschaffenen Saalgarten auf der Südseite der Klosteranlage bewundern.
Den Brunnen und Gärten galt die volle Aufmerksamkeit Abt Hartmanns, eine Vorliebe, die er mit vielen seiner Standesgenossen teilte. Der vor der Westfassade liegende Abteigarten, der schon unter seinen Amtsvorgängern mit Balustraden, Sommerhäusern und Brunnen ausgeschmückt worden war, wurde erneut umgestaltet. So kam beispielsweise ein Glashaus für die Überwinterung exotischer Pflanzen hinzu.
Auch für die Gartengestaltung nutzte Abt Joseph anscheinend seine Kontakte nach Würzburg. Von der Hand des Würzburger Künstlers Balthasar Esterbauer stammen der Aufsatz für den neuen, vermutlich vergrößerten Schalenbrunnen im Abteigarten sowie ein Großteil des Figurenschmucks für diesen Gartenteil. Der Schalenbrunnen vereint dabei auf seinem Schaft das Wappen Abt Hartmanns und das seines Vorgängers Franz Wundert.
Hinter den Klausurgebäuden wurde im Osten ab 1706 ein in den Quellen als Konventgarten bezeichneter Gartenteil angelegt, den man sich als Pendant zum westlich gelegenen Abteigarten vorstellen muss.
Die Anlage und Vollendung des südlichen Saalgartens erlebte Abt Joseph nicht mehr. Es ist aber anzunehmen, dass er diese Gartenanlage, den neuen Garten, der seinen Festsaal in die Natur fortsetzt, bereits in seinen Bauplanungen vorgesehen hatte. Die Abtei Bronnbach präsentierte sich mit diesen Gärten als prachtvolle, wenn auch kleine Residenz.
Auch den Wirtschaftsgebäuden galt die Aufmerksamkeit des Abtes, die landwirtschaftlichen Erträge bildeten schließlich einen nicht unwesentlichen Teil des Klostereinkommens. 1715 bis 1718 wurde vom Würzburger Hofbaumeister Joseph Greissing das sogenannte Schütthaus mit einem großen darunterliegenden Weinkeller aufgeführt. Kurz zuvor hatte der Architekt schon das neue Gasthaus vor den Toren Bronnbachs erbaut. Über dem Abtswappen am Schütthaus (heute: Schreinereibau) ist eine sehr lebensnah gestaltete Halbfigur mit Mitra, Infuln und Soutane zu sehen. Dabei könnte es sich durchaus um ein Porträt des Abts handeln.
Neben den Baumaßnahmen in Bronnbach kümmerte sich Abt Joseph auch um die Klosterdörfer und Höfe. Er veranlasste 1713 den Neubau der Pfarrkirche in Reicholzheim und 1721/22 den der Kirche in Dörlesberg, wovon bis heute seine Wappen künden. Auf dem Dürrhof bei Rauenberg wurde zwischen 1718 und 1722 ebenfalls eine neue Kapelle errichtet.
Die vielfältigen Baumaßnahmen bedeuteten eine gewaltige finanzielle Belastung für das Kloster. Nachzulesen ist dies in den Klosterrechnungen. So war es günstig, dass in diesen Jahren der Frankenwein hoch im Kurs stand und Abt Joseph ab 1700 in unmittelbarer Nähe des Klosters am Pfortenrain einen neuen Weinberg anlegen ließ. Dieser wird nach dem Abt bzw. der 1720 darin aufgestellten Joseph-Statue Josefsberg genannt.
Bei den Baumaßnahmen auf den klösterlichen Höfen handelte es sich zur Regierungszeit von Abt Hartmann im Wesentlichen um Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen. Eine Ausnahme bildete der Kemmelhof, der um 1715 als Neuanlage an der Gemarkungsgrenze zu Urphar errichtet wurde.
Trotz guten Wirtschaftens überforderten die zahlreichen Baumaßnahmen zeitweilig die finanzielle Leistungsfähigkeit des Klosters, was auch dem Konvent nicht verborgen blieb. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich allmählich Befürchtungen breitmachten und kritische Stimmen zu hören waren. Dennoch wurden 1719 vom Kloster Salem 10.000 Gulden aufgenommen. Mit der Rückzahlung dieses Darlehens waren noch die beiden Amtsnachfolger Abt Hartmanns befasst, sie zog sich bis 1778.
Das aktuelle Erscheinungsbild der Klosteranlage Bronnbach ist also ganz wesentlich von der Bautätigkeit Abt Joseph Hartmanns geprägt. Und um einem weit verbreiteten Irrtum entgegenzuwirken: Wie Louis J. Lekai in seiner Geschichte des Zisterzienserordens feststellt hat, waren im Allgemeinen barocker Glanz und äußeres Wachstum mit einer gleichermaßen eindrucksvollen moralischen Wiedergeburt und einem hohen Stand monastischer Disziplin verbunden. Dies galt auch für Bronnbach.